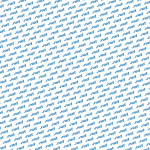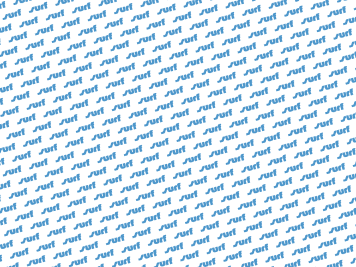“In Mosambik unterwegs zu sein und täglich zwei bis drei Stunden auf Facebook herum zu trollen, ist echt traurig.“ „Warum“, fragte Jules, „ich muss doch wissen, was so in der Welt los ist, und ich muss mein Profil pflegen, meine Fans lieben das, und meine Sponsoren bezahlen mich dafür!“ „Ist dir eigentlich klar, dass du schon ein Drittel deines Lebens mit Schlafen verschenkst? Das, was dich hier umgibt, ist echt und großartig, weil es anders ist als bei dir Zuhause. Facebook ist nur virtuell und überall auf der Welt gleich. Mach das Zuhause, wenn es regnet, aber doch nicht unter diesem blauen Himmel an wundervollen weißen Stränden und fabelhaften Point Breaks.“
„Komm mal runter, Gilles“, erwiderte Thomas. „Jules kann doch machen, was er will. Du klingst echt ein bisschen ‚Old School’ – auch wenn ich dir zum Großteil zustimme. Aber das ist heute halt so, sie brauchen ihr Facebook und Instagram. Es ist wie eine Sucht.“ „Eine Sucht?“ keifte Jules. „Ihr seid doch verrückt. Das ist einfach nur ein Trend und dem folge ich. So einfach ist das!“ „Apropos Sucht – lass uns mal checken, was hinter der Felsnase ist. Ich hab das Gefühl, dass sich eine gute Welle mit Side-Offshore-Wind dahinter verbirgt. Die Suche, das ist meine Sucht und das ist ein gute.“
„Pah – geht doch! Ich habe keine Lust darunter zu laufen und auf eine Cobra oder eine giftige Spinne zu treten. Ich warte auf euch im Auto und checke Facebook.“ „Na komm, Gilles, dann gehen wir beide halt allein“, erwiderte Thomas trotzig.
Wale, aber keine Wellen
Nein, es war keine Welle hinter dem Felsen. Doch der Weg dorthin war ein Muss. Während wir über die Felsen liefen, die die Wellen geformt hatten und die über türkisem Wasser hingen, erspähten wir mindestens ein dutzend Wale, die mit ihren Kindern nur einen guten halben Kilometer weit draußen herumtollten und eine Delfinschule, die sich im Shorebreak vor dem einsamen Strand vergnügten. Außer einem Fischer mit seiner selbstgebauten Harpune und einer Tasche voll mit Lobstern trafen wir keine Menschenseele.
Es war unser achter Tag in Mosambik und es blieben uns weitere acht bis zu unserer Abreise... und aus Windmangel waren wir bislang nur wellenreiten. Doch heute legte der Wind langsam los, leider aus der falschen Richtung. Normalerweise bläst hier ein Südwind, der perfekt sideshore an unserem Spot Tofino mit seinem Point Break wehen würde. Doch nun blies der Wind aus Nordost, was nicht in Tofino und den umliegenden Spots funktionierte. Wir mussten uns also dringend einen Spot suchen, an dem Wind und Wellen zusammenpassten.
Ab in den Süden von Mosambik
Das blödeste war, dass gleich um die Ecke eigentlich ein Spot mit der richtigen Wellenrichtung war, doch wir mussten feststellen, dass der Wind dort fast platt auflandig wehte. Zurück in unserer Mozambeat Lodge hellten wir unsere Stimmung mit einem frischen, halb rohen Thunfisch-Steak mit Reis und frischem heimischen Salat auf und checkten die Windvorhersage. Übermorgen sah es sehr vielversprechend an dem Spot aus. Aber was sollten wir morgen machen? „Lass uns Richtung Süden fahren“, sagten Thomas und ich gleichzeitig, während Jules so fatalistisch auf Facebook unterwegs war wie ein Local, der mit politischer Korruption oder einem Jahr ohne Regen konfrontiert wurde.
„Nach Süden, wohin und warum?“ erwiderte Jules, ohne seine Augen von seinem geliebten iPhone 6 zu nehmen. „Wenn du dir nur einmal die Karte von Mosambik angeschaut hättest statt nur deine unsinnigen Social Media News zu checken, dann wüsstest du, dass die Küste weiter im Süden nach Westen abknickt und der Wind dort beschleunigt und genau sideshore bläst“, konterte ich genervt. „Du träumst doch“, raunzte Jules zurück. „Tut er nicht. Hier schau, Windguru sagt 60 Kilometer weiter im Süden fünf Knoten mehr an“, unterstützte mich Thomas. „Das probieren wir, aber wie finden wir dort einen Weg ans Meer, es gibt ja keine Schilder an den Straßen, wenn es überhaupt Straßen gibt.“ „Mit meinem iPhone und Google Earth“, grinste Jules. „Ihr müsst zugeben, diese kleine Schönheit ist eine große Hilfe, wenn man in einem wenig entwickeltem Land unterwegs ist.“
Welchen Einfluss hat Social Media auf Windsurfer?
„Ich habe nie behauptet, dass ein Smartphone nicht sinnvoll für solche Sachen ist. Ich sage nur, dass die Art und Weise, wie ihr jungen Leute Social Media nutzt, ziemlich traurig ist, weil ihr eure Frustration damit ständig steigert und den Sinn für die Realität verliert.“
„Frustration steigern? Ich bin nicht frustriert! Du vielleicht, weil du kein iPhone hast. Und was glaubst du eigentlich, wer du bist, dass du anderen deine Realität aufzwingen willst. Lass uns jungen Leute doch bitte unsere eigene finden.“
„Du meinst, zum Sklaven der Postings zu werden – ist das deine Realität?“
„Jungs, wir haben noch gut zwölf Stunden bis Sonnenaufgang“, meinte Thomas. „Lass uns das ausdiskutieren und mal objektiv feststellen, welchen Einfluss Social Media auf uns und vor allem auf unser Leben als Windsurfer hat. Das wird bestimmt lustig und interessant.“
Die Playlist in der Bar war gut und der einheimische Rum großartig (so lange man ihn mit Limetten und Rohrzucker mischte) und wir sprachen, tranken und lachten fast die ganze Nacht. Im nächsten Kapitel werden wir euch verraten, zu welchem Schluss wir am Ende bezüglich Facebook gekommen sind. Ziemlich interessant, glaube ich. Aber bevor wir dieses Kapitel schließen, sollt ihr noch wissen, dass wir uns am nächsten Tag auf dem Weg in den Süden trotz Google Earth einige Male ziemlich verfranst haben, beinahe im Treibsand versunken wären und nur Dank der Hilfe eines Locals – der übrigens barfuß durch die trockene Savanne voll mit tödlichem Getier lief – den Zugang zum Strand fanden. Er hieß Praia da Zavora und offerierte uns eine schöne Linkswelle mit Sideshore- Wind. Wir hatten noch gute zwei Stunden vor Sonnenuntergang, der hier bereits um fünf Uhr ist und Thomas und Jules ritten die Wellen bis in die Dunkelheit hinein ab.
Die dunkle Seite von Facebook
In einer Studie habe ich mal gelesen, dass 70 Prozent der Leute, die Social- Media-Plattformen benutzen, berichten, dass ihr Selbstwertgefühl abstürzt, nachdem sie auf Facebook waren und dass sie, je mehr sie es benutzen desto mehr Neid und Unzufriedenheit empfinden. Warum ist das so? In der Vergangenheit haben es die Windsurf-Magazine schon ganz gut hingekriegt, dass man das Gefühl hatte, sein eigener Homespot wäre ziemlicher Mist, es sei denn man lebt am Strand von Hookipa. Aber die Magazine können in dieser Hinsicht nicht im Entferntesten mit dem Internet mithalten. Log dich einfach mal in einen x-beliebigen Instagram-Account eines Windsurfers ein und du wirst schnell das Gefühl bekommen, der einzige Mensch auf der Welt zu sein, der nicht täglich eine nie enden wollende türkise Welle bei perfektem Sideoffshore-Wind abreiten darf. Du denkst, dein Sonnenuntergangsfoto ist cool? Bullshit! Schau dir nur die auf Facebook geposteten an: Ein wunderschöner Regenbogen spannt sich über einen perfekten Spot. Und ja, deine Freundin verblasst tatsächlich hinter diesen anmutigen Strandschönheiten in ihren roten Bikinis. Und wenn wir über Windsurf-Selfies sprechen: Hör besser auf, dein dummes Gesicht zu posten, während du eine mickrige 30-Zentimeter-Welle an einem grauen, nebelverhangenen Spot runterrutscht. Nein, und auch deinen armseeligen Sprungversuch möchte niemand sehen.
Social Media löst bei uns allen Frustration aus, das ist klar. Aber was ist mit den Profi-Windsurfern selbst, bei deren Posts wir unser Leben im Allgemeinen und als Windsurfer im Speziellen als ziemlich minderbemittelt empfinden? Auch deren Leben hat sich durch Social Media gewaltig verändert.
Social Media ist für die Vermarktung der Profis wichtig geworden
Bevor Facebook in unser Leben trat, sagen wir mal so vor etwa zehn Jahren, da musstest du, um ein bekannter Windsurfer zu werden, wirklich rippen, du musstet, speziell bei Contests, auf Weltklasse-Niveau surfen. Das Ziel war, die Spots vor einer großen Menschenmenge zu zerlegen oder zumindest vor der Linse eines echten Profifotografen. Nur so konntest du durch Coverage in den Magazinen bekannt werden und deine Sponsoren zufriedenstellen. Heute musst du eher ein Social-Media-Experte sein, um das zu erreichen. Nur ein Beispiel. Ich frage euch: Habt ihr von Alice Arutkin jemals Footage vom Windsurfen gesehen? Versteht mich nicht falsch, ich will Alice gar nicht kritisieren und natürlich meine ich nicht, dass sie keine gute Windsurferin ist. Das kann ich nicht sagen, denn ich habe sie noch nie windsurfen gesehen. Und das ist genau der Punkt. Ihr Aufstieg zur „Pro Windsurferin“ hat sie mehr ihrer Facebook-Berühmtheit als ihrem Können auf dem Wasser zu verdanken. Alice trägt für gutes Geld eine Red-Bull-Kappe, Thomas nicht. Er rippt, aber er postet so gut wie nie etwas. Alice ist nur ein Beispiel. Es gibt genügend andere, die es sehr gut verstehen, sich in Szene zu setzen und damit eine Armee von Followern zu generieren – und denen folgen die Sponsoren.
Durch möglichst viele Posts auf Facebook wirst du weder Weltmeister noch machen sie dich glücklicher”
Ein weiteres Problem ist, dass all diese Posts eine üble Sorte von eitlen, selbstverliebten Windsurf-Persönlichkeiten heranzieht und durch die ständige Überdokumentation die wundervolle Magie des Windsurfens selbst verloren geht. Windsurfen ist die Interaktion zwischen dir und den Elementen, dem Wind, der Brandung, der Strömung, der Tide, dem Riff und so weiter. Es geht nicht darum, dass deine schöne Freundin vor einer GoPro posiert, während du im Hintergrund eine Air Jibe probierst.
Drei Tage voller Windsurf-Action
Und eigentlich sollte klar sein, dass Jules sich jetzt, wo sich am Strand tatsächlich die ersehnten Bedingungen einstellen, mit dem Windsurfen beschäftigen sollte anstatt mit dem Kopf über dem Smartphone zu hängen. Doch es sieht so aus, als würden wir mehr als eine Nacht mit einigen Gläsern Rum benötigen, um seine Einstellung zu ändern.
Kaum hatte Jules allerdings sein Brett im Wasser, hatte er schon die richtige Einstellung gefunden. Er kämpfte mit Thomas um die besten Wellen und beide feierten ein wahres Festival mit radikalen Top-Turns und Aerials – drei Tage hintereinander ging das so. Der letzte brachte den meisten Wind und erlaubte es Thomas und Jules, sich mit fetten Backloops in die Umlaufbahn zu schießen.
Der Point Break erwacht – ganz kurz
Nach einem wohlverdienten Ruhetag drehte der Wind endlich auf Süd. In der Hoffnung, dass der Point Break von Tofino nun endlich zum Leben erwachen würde, waren wir bereits um sieben Uhr morgens am Strand. Die Wellen waren zwar nur etwa einen Meter hoch, doch sie liefen perfekt und die Vorhersage versprach, dass sie bis zum Mittag noch deutlich größer werden sollten. Also entschlossen wir uns, später wieder zu kommen. Um genau elf Uhr war Thomas auf dem Wasser und ritt seine erste Logo-hohe Welle ab. Gleich nach dem Start carvte er in einen schnellen Bottom Turn, zog zur Lippe hoch und flog mit einem Aerial über die erste Close Out Section der Welle. Die Landung war super clean und mit Vollspeed setzte er zu einem 360er an, stand ihn locker, um wenig später noch einen Taka in die Wellenfront zu zirkeln. Wie viele Punkte hätte er wohl für so einen Ritt im Contest bekommen? Wie konzentriert und selbstbewusst muss man sein, um all dies auf der ersten Welle an einem unbekannten Spot zu machen? Das zu bewerten überlassen wir euch, weil es keine Fotos davon gibt, denn ich war immer noch dabei, meine Kamera in Stellung zu bringen, während all dies geschah. Auch Jules trimmte noch sein Segel. Wir waren uns einig, dass der Ritt eigentlich zu gut war, um wahr zu sein. Fünf Minuten später regnete es wie aus Kübeln und der Wind starb einen schnellen Tod.
Natürlich kamen wir am Nachmittag, nachdem der Regen aufgehört und der Wind wieder eingesetzt hatte, zurück. Doch der Windswell hatte den Groundswell ein wenig zerstört und auch die Strömung machte die Wellen kleiner. Die Jungs waren aber trotzdem drei Stunden auf dem Wasser und Thomas gelangen noch einige 360er – aber nichts davon kam an Thomas’ erste Welle heran.
Abschiedsvorstellung in Tofo
Die folgenden Tage brachten ähnliche Bedingungen, Tofino blieb blass und konnte nicht ansatzweise sein Weltklasse-Potenzial entfalten. Trotzdem erwischten wir noch zwei gute Sessions: Eine in Praia da Barra und eine weitere in Praia da Tofo. Barra hat einen großen und schönen weißen Sandstrand, der nach Nordosten ausgerichtet ist. Der Südwind bläst side-offshore und wir entschieden uns, in der Mitte der Bucht ins Wasser zu gehen, weil er dort am stärksten war. Bei Hochwasser bildete der Windswell eine schöne Welle über den Sandbänken und ich konnte erkennen, dass die Jungs wirklich viel Spaß hatten. Allerdings muss ich zugeben, dass ich hinter der Kamera etwas neidisch war, denn das waren genau die Bedingungen, bei denen ich selber gerne surfen würde. Doch was ich mit der Kamera einfangen konnte, entschädigte mich für den seelischen Schmerz.
Die Kids am Strand verabschiedeten sich von uns, ohne nach Geschenken zu fragen. Sie dürfen in ihrem Paradies bleiben.”
In Tofo gaben wir so etwas wie unsere Abschiedsvorstellung. Es ist der eigentliche Touristenstrand der Gegend und ist gesäumt von Lodges und Hotels. Ein Kunstmarkt und viele Restaurants mit einheimischen Köstlichkeiten sind nur einen Steinwurf entfernt. Wir genossen die Livekonzerte und die guten Gespräche mit einheimischen und reisenden Surfern bei ein paar Bier gleich mehrfach auf unserem Trip. Bei Niedrigwasser bildet sich eine sehr saubere Rechtswelle, die die Jungs mit Goitern und fetten Aerials verzierten. Auf dem Weg zurück zum Auto wurden wir wie immer, wenn wir hier am Strand waren, von Local Surfer Kids umringt, die unser Material beäugten und uns Beutel mit Cashew-Nüssen oder selbst gebackene Donuts in Muschelform anboten. Wie jeden Tag kauften wir ihnen ein paar Kleinigkeiten ab, um ihnen eine Freude zu machen. Als wir ihnen sagten, dies sei unser letzter Tag hier, verabschiedeten sie sich per Handschlag, ohne noch mal nach kleinen Abschiedsgeschenken zu fragen. Nach all unseren Erlebnissen hatte ich das Gefühl, dass sie es waren, die im Paradies bleiben durften.
Epilog
Da sind wir nun auf der Straße nach Johannesburg, wo wir unser Auto gemietet hatten. Hinter uns liegt der verdreckte Molloch von Maputo mit seinen illegalen Müllhalden. In Südafrika fühlt man sich zurück in der modernen Welt, mit geteerten, markierten Straßen und Verkehrszeichen. Wir cruisen an einem schönen Fluss entlang durch ein Tal voll mit Orangenbäumen. Eine enspannte Fahrt nach zwölf Stunden mit permanentem Ausweichen vor Schlaglöchern, Fußgängern, Ochsenkarren und, dem schlimmsten überhaupt, unbeleuchteten Autos mitten in der Nacht in Mosambik. „Auch wenn wir Tofino nicht in Top-Form erlebt haben, war es ein toller Trip. Die Wellen sind doch nur der Bonus. Ich mag die zufälligen Erlebnisse zwischen den Windsurfsessions“, sagt Thomas während er fährt. „Meinst du die Abschiedsparty gestern?“, meint Jules grinsend. „Ja auch, aber eigentlich erinnere ich mich mehr an die Wale, die vor uns herumsprangen, die Affen an der Straße, die endlose Savanne mit ihren Millionen Kokusnuss- und Mangobäumen und die Männer, die vor ihren Hütten Gitarre spielten.“ „Während ihre Frauen barfuß mit ihren Babies vor der Brust und einem Bottich Wasser auf dem Kopf durch den Busch liefen“, ergänze ich. „Es ist dieses zeitlose Image von Afrika, das in Mosambik noch lebt, was ich so mag.“ „Ja, wenn man es sieht und wahrnimmt. Aber wenn man den ganzen Tag auf Facebook rumhängt... Aber nein, Jules ist bei weitem nicht der am stärksten Social-Media-Süchtige, mit dem ich in letzter Zeit gereist bin“, beschwichtige ich, bevor Jules antworten kann. „Facebook ist nur ein Symbol für das Hauptproblem, das sich im Profi-Windsurfen in den letzten zehn Jahren ausgebreitet hat. Es ist egozentrisch und parasitär geworden, es hat sich völlig losgelöst von dem Umfeld, auf das es angewiesen ist, von den Leuten, die an den abgelegenen Spots leben.“
Die Jungs, die nach Indo, Kapstadt oder Chile fahren, sollten sich weniger auf Social Media konzentrieren, als auf die Natur, die sie umgibt.”
„Gib mal ein Beispiel“, fordert Thomas. „Okay: Die erste Frage, die die meisten Profis heute stellen, wenn ich mit ihnen einen Trip plane ist: Wie lange dauert der Transfer vom Flughafen zum Spot? Das ist doch einfach nur schade, denn es sind doch die ungeplanten Momente und Erlebnisse, die einer Reise die richtige Tiefe geben.“ „Du meinst, die Jungs die nach Indo, Kapstadt oder Chile reisen, sollten sich weniger auf Social Media, Burger, Coca Cola und Fernsehen konzentrieren, als darauf, neue Menschen kennenzulernen, die Kultur zu verstehen und die Natur, die sie umgibt?“ „Genau!“ antworte ich. „Aber soll ich als Profi denn nicht das tun, wofür ich bezahlt werde, mit der Windsurfszene in Verbindung bleiben und meine Fans auf dem Laufenden halten, wo auch immer ich bin?“ wendet Jules ein. „Wofür?“ fragt Thomas, „Dadurch wirst du weder Weltmeister noch macht es dich glücklicher.“
„Hey Jungs, hört mal, was ich gerade gelesen habe. Die Worte stammen von einem weisen Surfer namens Mark Renneker: ‚Du surfst erst dann komplett frei, wenn du vor niemandem mehr angeben musst und keine Erwartungen mehr an dich selbst stellst‘.“ Jules legt sein Smartphone aus der Hand und schaut aus dem Autofenster auf die Berge.
Dieser Artikel erschien erstmals in surf 9/2016