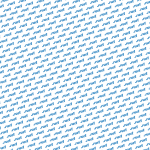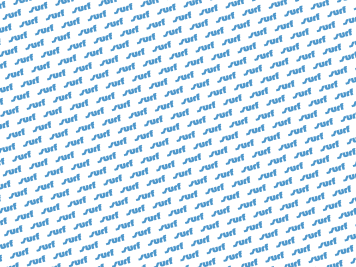Robby Seeger lebte einen Surfer-Traum: Vom kleinen Postsee bei Kiel trickste sich Seeger in den Worldcup, ergatterte Sponsoren und die Gunst der Medien. Statt Bundeswehr zog er nach Maui. Gesegnet mit Witz, Scharfsinn, Bewegungstalent und der nötigen Breitschultrigkeit erboxte sich Seeger einen Logenplatz in der Top-Riege der Waverider. Mehr noch: Seeger wurde Waterman, bevor es den Begriff überhaupt gab und Freestyler, als die Disziplin noch in den Kinderschuhen steckte. Ein VIP-Leben für Wind und Welle, mit Sponsorenschecks und „Eintritt frei“, wo immer er auftauchte. Doch das Schicksal schlug Haken. Statt die Sportler-Karriere zu planen, verjubelte Seeger sein Geld, verliebte sich in die falschen Frauen, stritt ums Sorgerecht seiner Kinder. Irgendwann waren die Siegeschancen vertan und die Sponsoren weg – doch unterkriegen ließ sich der Waterman noch lange nicht. Auch sein neues Projekt hat einen großen Fokus: das Meer – wie könnte es auch anders sein!
Robby, deinen Namen verbindet man mit der Riesenwelle Jaws. Wie wie wurdest du auf Jaws aufmerksam?
Beim Tischtennisspielen.
Beim Tischtennisspielen?!
Gerry Lopez (Wellenreit-Ikone – Anmerk. d. Red.) liebte Tischtennis. Er hatte eine Platte in seinem Haus und freute sich über Mitspieler. Ich war damals 18 Jahre alt, spielte gerne und gut. Gerry erzählte, dass er in den 1970ern versucht hatte, Jaws zu surfen, doch durch den Shorebreak war kein Durchkommen. Übrigens: Jaws sagte damals niemand. Auch nicht Peahi – das ist der hawaiianische Name für das ganze Gebiet. Der Spot nannte sich damals Domes.
Warum Domes?
Auf der Steilküste stand eine verfallene Windmühle. Sie sah aus wie ein Dom und war der Orientierungspunkt. Hier musste man vom Highway in die Ananasfelder biegen, wollte man zur Klippe über dem Spot gelangen. Erst hieß der Spot also Domes, später Jaws. Doch nicht, weil die Welle wie ein Hai zubeißt, sondern weil es dort viele Tigerhaie gibt. Später besann man sich auf Peahi. Ich mag den Namen Peahi am liebsten.
Wann warst du zum ersten Mal dort?
Ich fuhr Anfang der 1990er oft zum Fischen mit meinem Boot den North Shore hoch Richtung Hana. Nach Hookipa wird die Küste wild und unzugänglich; die Gewässer gelten als „sharky“ – deswegen war da niemand. Als ich bei einer dieser Fahrten das viele Weißwasser sah, fuhr ich näher hin. Die Welle sah beeindruckend aus. Ich stellte den Motor aus, denn ich wollte die Strömung checken. Strömungen machen manche Wellen unreitbar. Doch hier schien es okay.
Und beim nächsten Mal war Windsurf-Gear an Bord!
Richtig. Ich warf den Anker und ging Windsurfen.
Demnach warst du der erste Windsurfer in Jaws.
Ich mag die Floskel: „Ich war der Erste“ nicht. Aber ja, ich war der erste Windsurfer in Jaws.
Wann warst du das letzte Mal dort?
Erst kürzlich. Ich bin rausgeschwommen, die Welle war nicht sonderlich groß, aber es fühlte sich gut an, im Wasser zu sein. Die Energie des Meeres ist dort ganz besonders.
Wie kommt’s, dass die Windsurfer untern Teppich gekehrt werden, wenn es um Big-Wave-Surfen geht?
Keine Ahnung. Dabei sind wir Windsurfer die Pioniere des Big-Wave-Surfens. Gutes Beispiel: Wellenreiter Ken Bradshaw erhielt den „Guinness Book of Record“-Award mit seiner 85-Fuß-Welle, die er 1998 am Northshore von Oahu ritt, doch meine Welle in Peahi in diesem Jahr war höher.
Wie hoch?
Ich glaube, dass sie damals an die 100 Fuß (30 Meter) ran kam. Denn die Tube war voller Weißwasser – das siehst du nie. Und die Lippe fiel senkrecht runter wie ein Wasserfall. Auch das siehst du nie. An dem Tag war ich alleine draußen. Sogar Johnny Boy Gomes schüttelte mir danach die Hand und gratulierte. Gomes war ein Typ zum Fürchten von den legendären „Da Hui“-Surfern in Oahu.
Du warst an dem Tag allein draußen – kein Jetski?
Alleine.
Was hättest du gemacht, wärst du gestürzt?
Gar nix.
Auftriebsweste?
Das war lange bevor es Aufblas-Westen gab.
Wipe-outs in Jaws gelten als purer Horror.
Ich bin in Peahi sogar „over the falls“ gegangen. Super fies. Das bedeutet, dass dich die Welle hochsaugt und du mit der Wellenlippe nach unten donnerst. Einmal erwischte mich ein ganzes Wellen-Set. Vor der ersten Welle musste ich alles loslassen, sprang vom Board, bekam die Welle auf den Kopf. Eine nach der anderen. Die fünfte Welle war riesig. Sie schlug fünf Meter vor mir ein. Da kannst du nicht abtauchen, denn die Wellenlippe hämmert zu tief ins Wasser. Ich versuchte es dennoch, kam nicht mal einen halben Meter runter, als mich das Ding traf. Ich verlor das Bewusstsein.
Ohnmächtig unter Wasser!
Ich erinnerte mich an nichts mehr. Ich weiß nur, dass ich irgendwann anfing zu zählen und versuchte, nach oben zu kommen. Doch da liegt das Problem. Im Weißwasser verlierst du die Orientierung, weißt nicht mehr, wo oben und unten ist. Oder du schaffst es an die Oberfläche, doch da ist so viel Schaum, dass du nicht atmen kannst und die nächste Welle brauchst, die den Schaum wegspült.
Und dann?
Ich zählte 22 Armzüge, bis ich wieder an der Wasseroberfläche war. Ich muss also richtig tief unten gewesen sein.
Hat dich diese Nahtod-Erfahrung traumatisiert?
Nein. Damals war ich regelrecht besessen von Peahi. Ich hatte verdammt viel Zeit in großen Wellen verbracht – irgendwann fühlte sich das normal an. „Normal“ ist das falsche Wort – es fühlte sich richtig an – ich habe ein Waterman-Leben gelebt.
Wie viel ist von dem Waterman heute noch übrig?
100 Prozent. Das geht nicht mehr verloren. Einmal Waterman, immer Waterman. Das Meer ist mein Zuhause.
Sprich: Du kannst jederzeit in Jaws rausgehen.
Ja, kann ich, doch ich muss nicht. Es fühlt sich gut an, wenn du bewundert wirst, doch mein Ego braucht das nicht mehr. Früher bin ich oft nur gesurft, um Beifall zu kriegen – doch darum geht’s nicht. Das spürst du besonders, wenn du älter wirst. Ich habe erst gemerkt, was mir Windsurfen bedeutet, als ich die Freiheit verloren habe, einfach „nur“ windsurfen zu gehen.
Wie meinst du das?
Na ja, irgendwann waren die Sponsoren weg. Dann stand ich da mit meinem Realschulabschluss. Geldhahn zu! Ich habe Shuttlebusse gefahren, Häuser gebaut, Wildschweinjagden für Millionäre auf Molokai organisiert, Zementwände hochgezogen, habe einen 50jährigen Bänker trainiert, dass er Jaws surfen kann, werkelte in praller Hitze auf Dächern, arbeitete als Grundstücksmakler, schwamm als Kameramann bei den Pipe-Masters im Meer und verbrachte danach ewige Tage im Schneideraum – da merkte ich erst, wie besonders meine Windsurf-Zeit war. Wie toll, die Welt zu bereisen, Champagner zu trinken und Telefon-Nummern von hübschen Stewardessen zu kriegen.
Realitiy-Check!
Und was für einer. Denn das Leben kann hart sein und das Geldverdienen ein Knochenjob, gerade auf Hawaii. Am Höhepunkt meiner Sportkarriere fragte mich Alois Mühlegger vom surf Magazin. „Robby, was willst du nach dem Windsurfen machen?“ Damals dachte ich: Wovon spricht der Typ? (Lacht).
Windsurfer in den 1990ern waren Rockstars und die einzigen wirklichen Funsportler!”
Weil du dachtest, das geht ewig so weiter.
Na, logisch: Rockstar all the way! Im Flugzeug wurde durchgesagt: „Mister Seeger, Special Service is waiting for you at the Gate.“ Ich wurde mit einem Golfchart durch den Flughafen gefahren, Platin for Life. Überall wurde ich hofiert. In Japan bekam ich einen Privat-Chauffeur. Als Profi-Windsurfer hattest du einen Status wie heute Ken Roczen und ein Image wie jetzt Wingsuit-Basejumper.
Damals wurdest du von den Medien gehypt. Es hieß, du könntest ein deutscher Robby Naish werden.
Sonne, Sand und Seeger, lautete eine Headline.
Damals waren die goldenen Zeiten im Windsurfen.
Oh ja. Es gab das Team Germany mit der Zigaretten-Firma West als Sponsor. Es war massig Geld da und meine Sponsoren erwarteten gar nicht, dass ich gewinne. Ich landete auf den 5. Platz, den 7. Platz, den 3. Platz. Während Björn zum dritten Mal Weltmeister wurde, zum 10. Mal Weltmeister wurde, zum 15. Mal Weltmeister wurde. Irgendwann hab ich mir gedacht: Ach, dann geh ich lieber Speerfischen oder Wellenreiten.
Hat dich Björns Dominanz frustriert?
Das war’s nicht. Mich hat das Gewinnen einfach nicht so interessiert. Das führte zu absurden Situationen. Ich fuhr mit meiner damaligen Freundin Angelina nach Hyères zum Worldcup. Ich lag auf einer super Position, der Weltmeistertitel in Reichweite. Als wir ins Fahrerlager rollten, hörte ich im Radio von Neuschnee in Chamonix. Ich zu ihr: Lust auf Snowboarden? Sie sagte ja, wir drehten um und fuhren snowboarden. Schon lustig!
Deine Sponsoren fanden das nicht so lustig.
Mag sein, doch mir war das egal – ich hatte damals Narrenfreiheit oder glaubte das zumindest. Ich schaffte es als erster Deutscher ins Finale des Aloha Classic. Das war ’ne richtig große Nummer, der Superbowl im Windsurfing.
Was war das Highlight deiner Windsurfkarriere?
Es gab viele Highlights, doch das Duell mit Robby Naish 1994 beim Worldcup auf Sylt sticht raus. Es erschienen zigtausend Zuschauer und ich kam ins Finale! Ich fühlte mich in Top-Form und fuhr Naish um die Ohren. Das war ein geiles Gefühl. Alles passte, sogar die Sonne tauchte alles in goldenes Licht. Ich erlebte einen Michael-Jordan-Moment. Am Ende entschieden die Wettkampfrichter für Naish. Aber ich war der Champion in den Augen des Publikums.
Du hast dem Worldcup viel zu verdanken.
Doch zu einem hohen Preis. Du bist zwei Drittel des Jahres auf Achse, mit all dem Material, tingelst von einem Event zum nächsten, wartest auf Wind. Ich erinnere mich an eine Saison, da haben wir bei elf Events auf Wind gewartet: eine ewige Rumsitzerei am Strand.
Du bist zwei Drittel des Jahres auf Achse, mit all dem Material, tingelst von einem Event zum nächsten, wartest auf Wind.”
Damals bist du in allen Disziplinen gestartet.
Kursrennen fand ich doof. Was schade war, denn hätte ich besser trainiert, wäre ein Titel drin gewesen. Slalom dagegen liebte ich. Das war schnell, aggressiv und strategisch spannend. Und Wave war eh meine Disziplin.
Wann hast du Freestyle für dich entdeckt?
Freestyle war schon immer mein Ding. Ich wurde an einem kleinen See groß, dem Postsee. Der hatte eine Anglerzone, ich durfte dem Ufer nicht näher kommen als 50 Meter. Da musste ich richtig kreativ werden und zwangsläufig das ein oder andere Manöver erfinden.
Wie viele Manöver hast du erfunden?
Ich habe eine Menge Manöver erfunden. Aerial Duck Jibe, Clue first 360er, Clue first Air Jibe, 540er, Lazy Susan, Tabletop Forward Loop, Bodydrag into Forwardloop into Air Jibe usw. (Lacht). Ich habe den ersten doppelten Forward in einem Wettkampf gesprungen oder bin in Peahi die Welle in Lee des Segels abgeritten – da kam so einiges zusammen in 20 Jahren als Profi-Windsurfer.
Gab es einen Windsurfer, der dich inspiriert hat?
Robby Naish. Egal, was Robby anstellte, er blieb mit dem Körperschwerpunkt immer überm Board. Das habe ich mir abgeschaut. Es ist erstaunlich, was du hinkriegst, wenn du einen durchtrainierten, starken Körper hast. Und den hatte ich. Die Freestyle-Nummer war da nur eine logische Folge.
Später wurde Freestyle im Worldcup aufgenommen.
Josh Stone, Brian Talma und ich waren die Fürsprecher. Das war heikel, denn keiner der Top-Dogs im Worldcup wollte sich mit den Amateuren vom Gardasee messen. Die waren nämlich verdammt gut. Als Weltklasse-Windsurfer musstest du nicht nur gewinnen, sondern haushoch gewinnen, um den Klassenunterschied zu zeigen. Das konnte ins Auge gehen. Mir war das egal, ich trat gerne gegen Alex Humpel, Michi Schweiger & Co. an. Zu der Zeit war der Worldcup lahm geworden, da musste was Neues her.
Freestyle!
Freestyle brachte neuen Wind in den Sport. Das begann mit dem „King of the Lake“ am Gardasee.
… der inoffiziellen Weltmeisterschaft der Freestyler.
Ja, das waren die World Championships der Freestyler – da wird mir jeder zustimmen. Organisator Alex Humpel hat ganze Arbeit geleistet und Red Bull hat das Potenzial erkannt. Denn plötzlich konnte der normale Windsurfer wieder Teil des Spitzensports sein. Der Profi-Zirkus hatte sich zu weit vom Hobby-Sport entfernt.
Dennoch hast du die Lust am Worldcup verloren.
Lust und Geld. Als 18-jähriger bin ich vom Worldcup in Japan mit 30.000 Dollar Cash in meinem Rucksack heimgeflogen. Als Francisco Goya später in Gran Canaria gewonnen hat mit brutalsten Doppelloops und reihenweise zerbrochenen Boards – ist er mit 5000 Dollar nach Hause gefahren. Lächerlich! Mein letztes Jahr im Worldcup habe ich mit 40.000 Minus auf der Kreditkarte abgeschlossen. Warum also der Stress? Ich hatte Lust auf andere Dinge. Große Wellen zum Beispiel.
Du warst Vorreiter im Freestyle und Big-Wave-Surfen.
Mit dem Los vieler Vorreiter. Nämlich, dass ich meiner Zeit voraus war. Erst viel später nahm Big-Wave-Surfen richtig Fahrt auf. Kai Lenny ist jetzt ein Mega-Star. Doch was er macht, beruht zu 80 Prozent auf den Dingen, die Rush Randle lange vor ihm gemacht hat. Damals war die Zeit noch nicht reif. Timing ist alles und mein Timing war immer ein bisschen daneben.
Du hättest eine Karriere hinlegen können als Waterman.
(Lacht) Ich war ein Waterman, bevor Waterman zum Begriff wurde. Während die anderen für Kursrennen trainierten, ging ich Speerfischen, Bodysurfen, Freitauchen usw. Selbst wenn ich ab jetzt nicht mal mehr meine große Zehe ins Meer strecken würde, ich werde immer ein Waterman bleiben. Denn ich habe verdammt viel Zeit im Meer verbracht.
Jetzt trifft Big-Wave-Surfen genau den Zeitgeist.
Schau dir Sebastian Steudtner an. Er kriegt vollen Support und hat angeblich sieben Porsches in der Garage stehen.
Das hättest du sein können.
Das war ich. 2008 startete ich das Projekt „Monsterwaves of Europe“. Wir sind die größten Wellen Europas gesurft. Auch Nazaré stand auf meiner Liste. Doch mein Vater starb und ich musste Nazaré sausen lassen. Dann kollabierte 2008 die Wirtschaft, die Sponsoren sprangen ab, meine Freundin erwartete das nächste Kind und das Leben ging anders weiter.
„Monsterwaves of Europe“ wäre heute vermutlich eine Netflix-Serie.
Doch damals der Zeit voraus. Es fiel schwer, Sponsoren zu finden – genau wie jetzt für mein neues Projekt Epic Swim Maui. Red Bull sagt: Swimming ist nicht unser Ding. Dabei ist Expeditionsschwimmen super spannend. Da steckt so viel drin: Achtsamkeit, Ocean Health, Verbundenheit mit dem Element Wasser, die Besinnung auf die Einfachheit des Erlebens.
Du warst zwar ein sehr guter Windsurfer, doch wie hast du den Schritt zum Big-Wave-Surfer geschafft?
Ich bin kein guter Wellenreiter. Aber auch Sebastian Steudtner ist kein guter Wellenreiter; er ist eher ein Snowboarder auf Wasser. Für große Wellen brauchst du in erster Line Mut. Surfer-Ikone Brad Lewis sagte zu mir: Du musst es ausprobieren! Ich fing mit Tow-Surfen an. Zuerst an den Außenriffen, später in Peahi. Brad hatte recht, ich stellte fest: große Wellen liegen mir. Beim ersten Tow-Contest in Peahi mit Riesenwellen wurde ich Vierter mit meinem Tow-Partner Cheyne Horan. Bei den Nea-Awards 2002 nominierte man mich zum „Waterman of the Year“.
Und doch ist in deinem Leben viel schiefgelaufen. Hättest du dein Geld damals richtig angelegt, wäre dir eine Menge erspart geblieben.
Hätte ich alles richtig gemacht, dann wäre ich vielleicht gelangweilt gewesen im Überfluss – und nicht der Mensch, der ich jetzt bin. Früher habe ich die Kerze an beiden Enden angezündet, da war ich skrupellos und viel war mir scheißegal. Ich glaube, ich musste erst die andere Perspektive einnehmen, um zu begreifen, welche Freiheit ich damals hatte. Und da gehörte in meinem Fall viel Herzschmerz dazu, Kampf um die Fürsorge meiner drei Kinder, Geldnot, Malochen auf dem Bau usw. Aber ich bin dankbar, dass ich all das erleben durfte. Alles passt, keine Reue! Doch ich stelle fest: Das Schwierigste ist, einen zweiten Traum zu haben.
Was ist dein zweiter Traum?
Ich will Sport und Wissenschaft zusammenbringen. Mein neues Projekt heißt Epic Swim Maui. Ich organisiere ein Event, wo die besten Open-Water-Schwimmer der Welt um Maui schwimmen. Doch das ist mehr als Extrem-Sport, ich will damit sensibilisieren. Fürs Meer, die Gesundheit der Riffe, das Erbe, das unsere Kinder antreten werden. Ich finde, wir müssen ein Bewusstsein schaffen, wie sehr wir Menschen mit dem Meer verbunden sind. Checkt mal rein: epicswimmaui.com